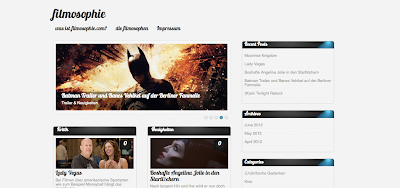Sophie's Berlinale wird wieder das sein, was es war: Ein Festival Blog, auf dem Kritiken zu Filmen der Berlinale zu lesen sind.
Aber das ist natürlich nicht das Ende meiner Tätigkeit als Kritikerin, sondern erst der Anfang. Denn nun habe ich mit www.filmosophie.com endlich einen Blog, bei dem der Name auch zum Inhalt passt. Hier findet Ihr ab jetzt alle Filmkritiken, die ich jenseits meines Berliner Festivallebens verfasse, sowie gelegentlich neue Trailer und Wissenswertes aus der Filmwelt. Gemeinsam mit weiteren Autoren werde ich außerdem neben "normalen" Kritiken auch ein paar Kolumnen zu filmverwandten Themen verfassen. Ein Blick auf meine neue Seite lohnt sich also!
Bis bald auf www.filmosophie.com !!
Montag, 25. Juni 2012
Mittwoch, 20. Juni 2012
Lady Vegas
 |
| © Wild Bunch/Regie: Stephen Frears |
Beth (Rebecca Hall) hat das Strippen satt und will stattdessen als Cocktail-Kellnerin in den Casinos von Las Vegas arbeiten. Doch dieser immense Karrieresprung gelingt ihr nicht. Stattdessen erlangt sie über Kontakte einen Job bei dem Berufsspieler Dink (Bruce Willis). Wie sich herausstellt, hat die naiv wirkende Beth durchaus eine Begabung für Zahlen und – im Gegensatz zu mir – auch ein Verständnis für das Sportwettenbusiness. Es könnte alles so schön sein, doch Dinks Frau Tulip (Catherine Zeta-Jones) hat natürlich etwas gegen die blutjunge Konkurrentin und zwingt ihren Ehemann, Beth zu entlassen. Die lässt sich aber nicht unterkriegen und will bei der Konkurrenz in New York durchstarten. Schade nur, dass das Glücksspiel in diesem Staat iilegal ist...
Es fällt schwer, einen kurzen Inhaltsabriss von Lady Vegas zu schreiben, denn die Storyline ist Drehbuchautor D.V. DeVincentis nicht sonderlich gut gelungen. Es fehlt der rote Faden, eine klare Agenda der Protagonistin abseits von „ich will mal etwas anderes machen als mich auszuziehen“. Erst in den letzten zwanzig Minuten kommt so etwas wie Spannung auf, aber auch an dieser Stelle krankt der Film daran, dass nicht jedermann das Wettgeschehen und somit die Brisanz der Situation durchblickt.
Ein Grund dafür, dass es Lady Vegas an keinem Punkt gelingt, sein Publikum mitzureißen, ist die Hauptfigur Beth, die einem vom ersten Moment an ziemlich auf die Nerven geht. Auch wenn die Geschichte im späteren Verlauf behauptet, Beth habe irgendetwas anderes als Hohlraum in ihrem hübschen Köpfchen, erscheint sie von Anfang bis Ende nicht nur naiv, sondern vor allem intellektuell reduziert. Wenn sie mit großen Augen Geldscheine zählt und dabei ausschaut wie ein Kleinkind im Spielzeugparadies, können wir es Tulip nicht verübeln, dass sie genervt mit den Augen rollt. Mir persönlich wäre es auch lieber gewesen, wenn Beths Dialoge etwas kürzer gewesen wären, denn die Quietschestimme, die Rebecca Hall hier an den Tag legt, macht den sowieso schon eher anstrengenden Film nicht angenehmer. Ohne Sympathie für die Hauptfigur aber, deren Schicksal die Handlung bestimmt, muss das Geschehen für den Zuschauer uninteressant bleiben.
Es gibt jedoch auch Highlights in Lady Vegas, namentlich Nebendarsteller Catherine Zeta-Jones und Vince Vaughn, der Dinks Konkurrenten Rosie mimt. Beide spielen zwar überzeichnete Charaktere, legen hierin aber so viel komödiantisches Talent an den Tag, dass die langweilige Story wenigstens durch ein paar Lacher aufgelockert wird. Ein persönliches Highlight war für mich das Wiedersehen mit Laura Prepon, die ich durch die Sitcom Die wilden 70er kennen und schätzen gelernt habe.
Da mir die Romanvorlage von der echten Beth Raymer unbekannt ist, kann ich nicht beurteilen, welchen Anteil Regisseur Stephen Frears und Drehbuchautor DeVincentis am Scheitern dieses Konzepts haben und wie viel auf das Buch selbst zurückzuführen ist. Interessieren würde mich allerdings, ob Beth auch im wahren Leben eine so nervtötende Person ist.
Insgesamt fällt mir kein guter Grund dafür ein, sich Lady Vegas im Kino anzusehen. Die Geschichte ist uninteressant erzählt, die Hauptfigur nicht sonderlich sympathisch. Abgesehen von verhaltenen Lachern über Catherin Zeta-Jones hat der Film keinen größeren Unterhaltungswert vorzuweisen. Wäre er nicht so prominent besetzt, wäre Lady Vegas in meinen Augen ein klarer „direct to DVD“-Kandidat.
KINOSTART: 19. Juli 2012
Dienstag, 19. Juni 2012
Bis zum Horizon, dann links!
 |
| © Neue Visionen/ Regie: Bernd Böhlich |
Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Bis zum Horizont,
dann links! will die Aufmerksamkeit des Kinopublikums auf eine wachsende, aber
medial unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppe lenken: Senioren. Eine sensible
und dennoch komödiantische Herangehensweise an das Thema ist Regisseur Bernd
Böhlich gelungen. So ganz überzeugen vermag das Endprodukt aber leider doch
nicht.
Im Zentrum der Geschichte steht Annegret Simon (Angelica
Domröse), die von ihrem Sohn in das Altersheim „Abendstern“ abgeschoben wird,
als dieser mit seiner Familie in die USA auswandert. Für Annegret ist dies der
Anfang vom Ende - keine neue Phase ihres Lebens, sondern die letzte. Mit ihrer
Frustration ist sie nicht alleine. Auch Eckehardt Tiedgen (Otto Sander) hat es
leid, sich mit unliebsamen Zimmergenossen zu quälen, nach den Regeln der
Heimleitung zu leben und das Leben nur noch als Beobachter zu verfolgen. Bei
einem Rundflug über Brandenburg, den die Seniorengruppe gemeinsam unternimmt,
kapert Eckehardt daher das Flugzeug und zwingt die Piloten Richtung Mittelmeer
abzudrehen.
Es ist Bernd Böhlich hoch anzurechnen, dass er mit seinem
Film auch einem jungen Publikum nahebringen will, was das Leben im Altersheim
für die Bewohner bedeutet. Annegrets Schmerz über diese letzte Lebensstation,
die Einsamkeit der Bewohner, der Verlust der Würde und der Selbstbestimmung
werden dem Zuschauer eindrücklich vor Augen geführt. Leider ist Böhlich in
seiner Darstellung letztendlich doch zu vorsichtig. Die Seniorenresidenz
„Abendstern“ gehört immer noch zu den wohnlichen Ausnahmeeinrichtungen und
spiegelt mit Sicherheit nicht den Alltag der meisten Senioren wider. Zudem
wirken viele der Darsteller – insbesondere Hauptfigur Annegret – deutlich zu
jung für ein Leben im Heim.
Auch an anderen Stellen kann Bis zum Horizont, dann links! nicht
überzeugen. So scheint das Altenheim nur über eine einzige Schwester (Anna
Maria Mühe als Amelie) zu verfügen, was zwar unter Umständen das reale
Betreuungsverhältnis in Pflegeeinrichtungen widerspiegelt, im Rahmen des Films
aber dennoch unglaubwürdig wirkt. Auch die Darstellung der Flugzeugentführung
hätte noch einer Vertiefung der Absurdität bedurft. Dass ein bewaffneter
Rentner eine Propellermaschine kapert, ist an sich ein recht unwahrscheinlicher
Vorfall, dessen glaubwürdige Inszenierung dem Regisseur einiges abverlangt.
Böhlich scheitert leider kläglich an diesem Unternehmen. Einen weiteren
Wermutstropfen stellt die Liebesgeschichte zwischen Amelie und Co-Pilot
Mittwoch (Robert Stablober) dar, die nicht halb so viel Charme besitzt, wie die
vorsichtigen Annäherungen zwischen den Senioren.
Dass Bis zum Horizont, dann links! nicht überzeugen kann,
darf nicht den Darstellern angelastet werden, die – Robert Stadlober
ausgenommen – ihren Figuren gekonnt Leben einhauchen. Die junge Schauspielriege
muss sich vor den Altstars und ihrem Spiel verbeugen, denn während Domröse und
Sander durch ihr Talent beinahe die ihrem Leinwandalter unangemessene
Kostümierung ausgleichen, ergeht sich Robert Stadlober in gnadenlosem
Over-Acting.
Erwähnenswert ist zudem die wirklich schöne Filmmusik, die
das insgesamt ruhige Erzähltempo ausgleicht und den Zuschauer mitreißen kann,
auch wenn sie an einigen Stellen vielleicht einen Tick zu sentimental geraten
ist.
Am Ende stellt sich vor allem die Frage, warum Schauspieler
wie Herbert Köfer und Us Conradi, die sich in einem dem Film angemessenen Alter
befinden, in die Nebenrollen verdrängt werden, während die deutlich zu jung
besetzten Hauptdarsteller ihnen zu Unrecht die Show stehlen. Herbert Feuerstein
ist trotz seiner 75 Jahre auch für den ihm zugedachten Randpart eindeutig zu
agil.
Insgesamt ist Bis zum Horizont, dann links! nicht mutig
genug, sein Thema angemessen zu präsentieren. An dem Thema Alter wird nur
leicht gekratzt, doch statt wahrhaft gebrechlicher Protagonisten werden uns
adrett gekleidete Hauptfiguren präsentiert, denen wir nächtliches Bettnässen
auch mit viel Wohlwollen nicht abnehmen können. Somit beraubt sich der Film
selbst seiner Überzeugungskraft und reduziert das Thema Senioren einmal mehr zu
einem müden Lächeln.
Mittwoch, 13. Juni 2012
Rock of Ages
 |
| © Warner Brothers/ Regie: Adam Shankman |
Auf dem gleichnamigen Broadway-Musical basierend erzählt
Rock of Ages die Geschichte eines einschlägigen Etablissements, dem „Bourbon
Room“, dessen Existenz auf dem Spiel steht. 1987 sind es die Rocker, die für
den moralischen Verfall von Los Angeles verantwortlich gemacht werden. An vorderster
Front kämpft die Bürgermeistersfrau (Catherine Zeta-Jones) für die Schließung
des Rock-Clubs. Ladenbesitzer Dennis (Alec Baldwin) und seine rechte Hand Lonny
(Russel Brand) sehen ihre letzte Chance im Abschiedskonzert der sagenumworbenen
Band „Arsenal“, deren Leadsänger Stacee Jaxx (Tom Cruise) nun eine Solokarriere
starten will. Doch der listige und durchtriebene Manager Paul (Paul Giamatti)
macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Ach ja, und dann ist da noch diese
Lovestory von diesem jungen Mädchen vom Lande (Julianne Hough als Sherrie), die
im „Bourbon Room“ als Kellnerin anfängt und sich in ihren Kollegen (Diego
Boneta als Drew) verliebt.
Ja, die Handlung ist nicht das Aushängeschild von Rock of
Ages. Ein Musical schaut man sich ja aber auch nicht wegen der atemberaubenden
Handlungstwists an, sondern wegen der Musik! Und die konnte zumindest mich
durchgehend begeistern. Dass die großen Rockklassiker allesamt „eingepopt“ sind,
schmälert den Genuss ein wenig, doch wer sich schon bei den ersten Tönen von
„More Then Words“ zur Jugendliebe zurück träumt und zu den Akkorden von „We
built this city“ das Luftschlagzeug bespielt, dem wird Rock of Ages trotzdem
Spaß machen.
Knallharte Rockmusik und das Musical-Genre passen eben auch
einfach nicht besonders gut zusammen. Wo Catherine Zeta-Johnes das Bein in
erstaunliche Höhen schwingt, können keine plärrenden Gitarrensolos erklingen.
Dass Rock of Ages sich in dieser ungewöhnlichen Mischung selbst nicht ganz
ernst nimmt, zeigt vor allem die Liebesgeschichte zwischen Drew und Sherrie.
Die Locken des ersteren lassen sich am besten als Prinz-Eisenherz-Gedenkfrisur
bezeichnen und Sherries Outfit unterscheidet sich auch nicht wesentlich von dem
der jungen Britney Spears. Spätestens
wenn Drew von seinem Manager dazu gedrängt wird, Teil einer Boyband zu
werden, ist der kritische Blick auf austauschbare Popsternchen nicht mehr zu
übersehen.
Den beiden weitgehend charakterlosen und letztendlich auch
vollkommen uninteressanten, weil gesichtslosen, Teeny-Ikonen wird mit Alec
Baldwin, Russel Brand, Paul Giamatti, Mary J. Blige und Tom Cruise ein extrem
charismatischer Cast gegenüber gestellt. Trotz all meiner Vorbehalten gegen Tom
Cruise muss ich seine Darstellung des exzentrischen Rockstars in den höchsten
Tönen loben. Er ist Stacee Jaxx durch und durch. Allein seine Körperhaltung
drückt die Arroganz der Figur aus, lassen uns den Scientologen vergessen und
nur noch den Rockmusiker sehen. Aber vielleicht ist Cruise selbst von seiner
Figur gar nicht so weit entfernt. Immerhin wird von Stacee mehrfach behauptet,
er würde satanischen Kulten frönen. So viel Selbstironie hätte ich Herrn Cruise
wahrlich nicht zugetraut!
Die Selbstironie ist der kritische Punkt an Rock of Ages,
denn ohne sie kann diese seichte, von Stereotypen durchsetzte Story auf der
Leinwand nicht funktionieren. Leider ist die kritische Distanz des Films zu
sich selbst nicht immer gleichermaßen deutlich: Nicht immer ist klar, wo wir
ihn ernst nehmen und wo lieber belächeln sollen. Diese kurzen Momente der
Irritation reißen uns als Zuschauer vorübergehend aus dem Musik-Universum
heraus.
Rock of Ages hat keine große Geschichte zu erzählen, teilt
aber großzügig Seitenhiebe auf Möchtegern-Rocker und Pop-Sänger aus. Dazu gibt
es viel Musik, die wir alle irgendwoher kennen, mit der wir Erinnerungen
verbinden und die für gute Laune sorgt. Wem das für einen gelungenen Kinoabend
reicht, der wird definitiv gut unterhalten werden. Und die Moral von der
Geschicht’: Rockmusik stirbt niemals nicht!!
Schönstes Zitat:
Sherrie: „I’m a stripper!“
Drew: „I’m in a boy band...“
Dienstag, 5. Juni 2012
Cosmopolis
 |
| © Falcom Media/ Regie: David Cronenberg |
Ein Milliardär fährt in seiner Limousine durch New York,
trifft seine Frau, Geschäftspartner, Berater und beobachtet durch die Fenster
des Wagens die Realität, zu der er keine Verbindung mehr spürt. Nicht viel Stoff
für einen packenden Film. Und doch hat Cosmopolis von David Cronenberg dieses
gewisse Etwas, das uns den Film so schnell nicht aus dem Kopf gehen lässt.
Eric Packer (Robert Pattinson) ist mehr als reich. Gerade
denkt er darüber nach, in seinem New Yorker Appartment einen Schießstand zu
installieren und eine komplette Kapelle, die ihm auf Grund der dortigen Gemälde
gefällt, in seine Behausung umziehen zu lassen. Seine Ehe ist im Eimer, obwohl
die Hochzeit erst wenige Monate her ist. Doch das ist nicht das einzige, das
sein Leben überschattet. Trotz seines bislang untrüglichen Instinkts hat sich
der junge Geschäftsmann verspekuliert. Der Bankrott droht. Und als wäre das
noch nicht genug, ist ihm ein Attentäter auf den Fersen. Doch Eric lässt sich
nicht aus der Ruhe bringen und nimmt eine Tagesreise durch New York in Kauf, um
den Friseur seines Vertrauens aufzusuchen. Das ist Dekadenz.
Einige Kollegen sind der Meinung, Cronenbergs neues Werk sei
mit Dialogen überladen. In der Tat wird Cosmopolis von den Gesprächen der
Charaktere dominiert, die auf einem immensen intellektuellen Niveau stattfinden
und sich eines Duktus bedienen, der sich jenseits unserer Alltagssprache befindet.
Manchmal fühlte ich mich gar an eine dieser modernen Shakespeare-Verfilmungen
erinnert, in denen die Sprache nicht zu den Bildern passen möchte. Hat man sich
jedoch erst einmal von dem Anspruch gelöst, jede Zeile zu verstehen, verschwimmen
die Dialoge zu einem abstrakten Geräuschteppich, in dem nur einzelne Elemente
durch Wiederholung eine Bedeutung erfahren. David Cronenberg hat seinen Film
ganz bewusst um die Originaldialoge von Romanautor Don DeLillo konstruiert und
diese größtenteils wortwörtlich übernommen. Auch wenn die Wortlast hiermit kein
Versehen, sondern künstlerische Absicht darstellt, ging mir das
pseudointellektuelle Gelaber spätestens nach einer halben Stunde ziemlich auf
die Nerven. Nur wenn wir die Dialoge als Werkzeug der Abstraktion begreifen, so
glaube ich, ist hinter ihrer scheinbaren Sinnlosigkeit eine Funktion erkennbar.
Cosmopolis spielt in einem Mikrokosmos: Erics Limousine.
Eine Schallisolierung verhindert, dass die Geräusche der Außenwelt zur
Hauptfigur und uns durchdringen. Die Akustik ist gewöhnungsbedürftig,
verdeutlicht jedoch, wie stark der Protagonist von der Realität getrennt ist.
Seine Welt ist die Abstraktion: Die Zahlen rattern über die Bildschirme der
Limousine und werden trotz ihrer Omnipräsenz meistens ignoriert. Sie sind nicht
mehr länger Zeichen für etwas real Existierendes, sondern nur mehr leere
Symbole, Simulakren. Auch die gestelzte Sprache und die ausufernden Dialoge - bedeutungsschwanger,
doch ohne echten Inhalt - passen in dieses Konzept. Cosmopolis ist eine
Abstraktion, die ihren Ausgangspunkt vergessen hat.
Während sich über die filmische Qualität dieses Konzepts
streiten lässt, so wird doch eines offenbar: Robert Pattinson kann schauspielern.
Es hat mich in hohem Maße überrascht, in seinen regungslosen Gesichtszügen
nicht ein einziges Mal den melancholischen Vampir zu entdecken. Sicher kommt es
ihm entgegen, dass ihm seine Rolle größtenteils Gleichgültigkeit vorschreibt.
Doch auch in den Momenten, in denen sich Eric für einen kurzen Moment aus
seiner emotionalen Erstarrung löst, bleibt Pattinson gleichsam glaubwürdig.
Cosmopolis ist ein gelungener Spiegel unserer Zeit, in der
die Realität immer absurder zu werden scheint. Wie Eric beobachten auch wir die
Welt nur durch Fenster: die Bildschirme unserer TV-Geräte und Computer. Wie er
sehen wir dort politische Protestbewegungen und die fast schon religiöse
Erhebung berühmter Persönlichkeiten, ohne daran wirklich teilzunehmen. Der Tod
eines Superstars rührt uns zu Tränen, während unsere zwischenmenschlichen
Beziehungen durch Distanz gekennzeichnet sind. Obwohl Cosmopolis durch seine
gestelzten Dialoge und die Ästhetik vollkommen artifiziell wirkt, steckt darin
doch eine Menge Wahrhaftigkeit.
Auch wenn wir die bis zu 20 Minuten andauernden Dialogszenen
als Stilmittel begreifen, sind gewisse Längen in Cosmopolis nicht von der Hand
zu weisen. Es hätte an einigen Stellen einer Raffung bedurft,
um die Handlung insgesamt dynamischer zu gestalten. Einen Spannungsbogen sucht
man hier ebenso vergebens wie einen zur Identifikation einladenden Charakter.
Die Figuren sind zu undurchschaubar, um ihre Gefühlswelt zu ermessen oder gar
nachzuvollziehen.
Trotz allem bleibt Cosmopolis in meinen Augen ein
beachtlicher, wenn auch absonderlicher Film, den zu verstehen von vornherein
der falsche Ansatz ist. Cosmopolis will nicht dekodiert werden, denn es ist ja
gerade die Aussage dieses Werks, dass hinter all den Worten und Zeichen kein
tieferer Sinn mehr zu finden ist.
KINOSTART 05. Juli 2012
Pressespiegel bei film-zeit.de
KINOSTART 05. Juli 2012
Pressespiegel bei film-zeit.de
Mittwoch, 23. Mai 2012
Street Dance 2 - Der Untergang des Tanzfilms
 |
| © Universum/ Regie: Max Giwa & Dania Pasquini |
Charaktere sind out
Während wir in DIRTY DANCING die Hauptfigur Baby (Jennifer
Grey) von Beginn an in unser Herz
schließen und ihren Weg vom Mädchen zur Frau mitverfolgen, weiß STREET DANCE 2
nur bloße Typen zu präsentieren. Ash (Falk Hentschel) fehlt nicht nur das
Charisma eines Patrick Swayze, ihm wird leider im Laufe der Geschichte auch nur
im Ansatz so etwas wie eine Persönlichkeit zuerkannt. Sein pathetisches
Voice-Over soll uns zwar suggerieren, dass es sich hier nicht um eine tanzende
Barbie-Puppe handelt, doch gelingt es den Regisseuren Max Giwa und Dania
Pasquini leider nicht, ihn in einen Menschen aus Fleisch und Blut zu
verwandeln. Und so bleibt Ash und seine gesamte Geschichte für uns im Grunde
total uninteressant. Auch sein Love-Interest Eva (Sofia Boutella) ist
weitgehend charakterbefreit. Mit derart formelhaft konstruierten Figuren kann auch
die Liebesgeschichte zwischen den beiden an keiner Stelle wirklich romantisch
werden.
Storys sind out
DIRTY DANCING hatte eine Geschichte zu erzählen. Bis das
erste Mal getanzt wird, vergehen ein paar Minuten: Baby muss erst einmal eine
Wassermelone tragen und sich blamieren, bevor sie und die Zuschauer erstmals
die sexy Performance des Hotel-Personals bewundern dürfen. STREET DANCE 2 spart
sich diesen unnötigen Handlungsfüllstoff. Hier geht es um nichts anderes als
den Tanzwettbewerb, den Ash unbedingt gewinnen will. Er stellt eine Truppe
europäischer Tänzer zusammen, zu der irgendwann die Latin-Queen Eva dazu stößt,
trainiert eine Choreographie ein und tritt am Ende gegen seinen Erz-Rivalen an.
Dass das nicht ganz für einen Kinofilm ausreicht, war offensichtlich auch Giwa
und Pasquini klar. Wie aus dem Lehrbuch kommt es daher nach zwei Dritteln
Laufzeit zu einer Art Konflikt, der so offensichtlich konstruiert ist, dass er
statt Spannung nur Stirnrunzeln erzeugt. Noch nie war die Formulierung „die
Geschichte entwickelt sich nicht aus den Charakteren, sondern wird ihnen
übergestülpt“ so treffend. Genauso verhält es sich auch mit dem Schlüsselereignis
eine Viertelstunde später, das die so überraschend entzweiten Liebenden dann
rechtzeitig zum Finale wieder aneinander schweißt. Ich sehe vor meinem inneren
Auge wie die Filmemacher zusammen sitzen und überlegen, wie sie den von
vornherein vollkommen unsinnigen Konflikt nun bereinigen könnten und sich dann
für den Klassiker „Sympathieträger wird todkrank“ entscheiden. Das muss im Film
auch gar nicht weiter erklärt werden, denn wir haben ja im Hollywoodkino schon
gelernt, dass ein solches Ereignis die Menschen wie von Zauberhand wieder zueinander
führt. Deshalb spart sich STREET DANCE 2 an dieser Stelle auch unnötige Dialoge
und kommt direkt zum Punkt: Wir haben uns alle wieder lieb. Ach, ist das schön!
Der Gerechtigkeit halber muss ich aber noch hinzufügen, dass
ich mir im Grunde für STREET DANCE 2 noch weniger Handlung gewünscht hätte.
Denn wann immer die Schauspieler meinen, sie müssten doch jetzt mal wieder
reden statt tanzen, standen mir vor lauter Fremdschämen die Nackenhaare zu
Berge. Das liegt nicht nur am fehlenden Talent der Darsteller, sondern auch an
den unmöglichen Dialogen. Als Eva nach der ersten – und familienfreundlich
komplett ausgeblendeten – Liebesnacht ihrem Ash ins Ohr haucht „... dann werden
wir von jetzt an alles teilen“, hätte ich mich am liebsten in meine
Popcorn-Tüte übergeben.
Rotierende Körper in drei Dimensionen
Wie schon der erste Teil, wurde auch STREET DANCE 2 in 3D
gedreht. Seit PINA bin ich ja der Meinung, dass der Tanzfilm das einzige Genre
ist, in dem die 3D-Technik eine Daseinsberechtigung hat. Und so nutzt auch
STREET DANCE 2 gekonnt die neue Bildtiefe, um uns die Körperbewegungen greifbar
nah zu präsentieren. Giwa und Pasquini hegen ohne Frage eine große Leidenschaft
für die Performancekunst Tanz. Das ist ihrem Werk anzusehen. Die rhythmische
Bewegung dient nicht nur als Augenweide, sondern ersetzt an einigen Stellen die
Handlung. Dabei entstehen immens ästhetische Aufnahmen, die das Tänzerherz
höher schlagen lassen und hundertmal mehr Atmosphäre transportieren als die
haarsträubenden Dialoge. Auch die Mischung von HipHop und Lateinamerikanischen Tänzen funktioniert, wobei letzterem Element nach meinem Geschmack mehr Screentime geschenkt werden dürfte.
Akrobatik statt Groove
Wenn man STREET DANCE 2 als typischen Tanzfilm unserer Zeit
begreift und ihn mit DIRTY DANCING vergleicht, fällt auf, dass der Tanz nicht
nur Selbstzweck wird, sondern sich gar von sich selbst entfremdet. Umso
absurder ist es, dass STREET DANCE 2 in seinen pathetischen Momenten eine
Botschaft davon zu vermitteln sucht, dass es beim Tanzen eben nicht um Selbstdarstellung,
sondern die Liebe zur Bewegung an sich ginge. Doch wenn akrobatische
Breakdance-Einlagen die Choreographien dominieren und die zahlreichen Montagen
die dargestellten Bewegungen von der Musik abzulösen beginnen, wird der Tanz zu
reinem Posing reduziert. Nein, es geht nicht mehr länger um die ästhetische
Bewegung, die mit der Musik verschmilzt, sondern um eine Demonstration der
eigenen Fähigkeiten. Hier bin ich, das kann ich – geil, oder?!
Und da kommen wir zu einem weiteren fundamentalen
Unterschied: Nachahmbarkeit. Ich kann mich noch erinnern, dass die finale
Choreographie von DIRTY DANCING zu „Time of My Life“ in meiner Kindheit und
Jugend eine beliebte Bühneneinlage bei Schulfesten und ähnlichen Anlässen
darstellte. Auch wenn die Hebefigur für Otto-Normaltänzer ebenso schwierig ist
wie für Protagonistin Baby, so konnte sich doch jeder wie die übrigen Tänzer
auf der Leinwand rhythmisch und sexy zur Musik wiegen und seine kreisenden
Hüften herausfordernd am Tanzpartner reiben. Bei STREET DANCE 2 geht das nicht
mehr. Die Kluft zwischen Zuschauer und Leinwandstar ist größer geworden.
Niemand wird beim nächsten Schulfest die Schlusschoreographie von STREET DANCE
2 tanzen. Zumindest nicht, ohne sich alle Knochen zu brechen.
Früher war alles besser. Auch die Tanzfilme. Sie hatten noch
Handlung, liebenswerte Charaktere und motivierten zur Nachahmung. Heute müssen
wir uns glattpolierte und vollkommen austauschbare Tanztypen ansehen, die mit
ihren akrobatischen Einlagen darüber hinwegtäuschen wollen, dass sie selbst die
simpelsten Dialoge nicht überzeugend rüberbringen können. Und statt die
Play-Station-Generation endlich mal von der Couch aufzuscheuchen, fordern Filme
wie STREET DANCE 2 lediglich zum passiven Konsum auf. Sich selbst zu bewegen
ist eben so unendlich 80er...
KINOSTART: 7. Juni 2012
Pressespiegel auf kino-zeit.de
Und im Vergleich noch mal ein kleiner Blick auf Dirty Dancing
KINOSTART: 7. Juni 2012
Pressespiegel auf kino-zeit.de
Und im Vergleich noch mal ein kleiner Blick auf Dirty Dancing
Montag, 21. Mai 2012
Men in Black 3
 |
| © Sony Pictures/ Regie: Barry Sonnenfeld |
Mit Aliens, die unerkannt unter den Menschen leben, kann ein
Film heutzutage niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken. Deshalb wird auch keine
Fortsetzung von Men in Black jemals an die Qualität des Originals heranreichen.
Immerhin aber bietet der dritte Teil genug Innovationen, um das Publikum nach
Hollywoodmanier angemessen zu unterhalten.
In MEN IN BLACK 3 treten Will Smith und Tommy Lee Johnes zum
dritten Mal als Agentenduo J und K auf. Während ihr Verhältnis wohl noch nie
als „herzlich“ zu beschreiben war, ist die Stimmung zwischen den beiden diesmal
besonders angespannt. J (Will Smith) vermutet, dass K (Tommy Lee Johnes) ihm
bedeutungsvolle Informationen vorenthält. Als sein älterer Kollege und Mentor
dann plötzlich verschwindet als wäre er niemals dagewesen und eine
Alieninvasion die Erde zu vernichten droht, muss J in die Vergangenheit reisen,
um mit dem damals 29jährigen K gemeinsam die Welt vor dem Untergang zu retten.
MEN IN BLACK 3 hat alle Zutaten, die dieses Franchise
braucht: Schwarze Anzüge, Sonnenbrillen und vor allem zahlreiche, kunterbunte
und ausgefallene Aliens (mein Favorit ist der sprechende Hefekloß, der sich
gemütlich auf einer heißen Herdplatte ausruht).
Make-Up Künstler Rick Baker hat sich hier erfolgreich ausgelebt und wie
schon in den ersten beiden Teilen der Reihe absonderlich-interessante
Außerirdische geschaffen. Der meist rein optische Reiz dieser Figuren ist
jedoch leider nur am Anfang präsent und bis auf Bösewicht Boris (Jemaine
Clement) verkommen die fantasievollen Geschöpfe im Filmverlauf zu Randfiguren. Optisch
nicht besonders spektakulär, dafür unterhaltsam ist allerdings die Figur des
Griffin (Michael Stuhlbarg), der in verschiedenen potentiellen Realitäten
gleichzeitig lebt und dessen leicht glasiger Blick sowie seine herzensgute und
friedliebende Art ihm beim Zuschauer Sympathiepunkte einbringen.
Das innovative Element von MEN IN BLACK 3 ist ohne Frage J’s
Reise in die Vergangenheit. Als Existenzberechtigung reicht diese Neuerung
allemal aus – es wurden schon Fortsetzungen mit weit weniger inhaltlicher
Weiterentwicklung gedreht. Leider bleibt bei der Inszenierung dieser Zeitreise
eindeutig Luft nach oben. Das Jahr 1969 manifestiert sich insbesondere durch
die Kostüme. Es scheint, als hätten die Komparsen in der Drehpause nur rasch
die Kleidung gewechselt. So richtig überzeugen kann die 60er Jahre Atmosphäre
nicht. Auch wenn ein kleiner Auftritt von Andy Warhol und der zu dieser Zeit
noch stärker präsente Rassismus in den USA ein wenig Zeitgeist vermitteln,
bleibt MEN IN BLACK 3 hier Meilen hinter seinem eigenen Potential zurück.
Natürlich kommt der Film, wie es sich heutzutage gehört, in
einer dreidimensionalen Version daher (das wäre doch mal ein Gag gewesen, wenn
der Film mit der Zeitreise von 3D zu 2D wechseln würde...). Im Gegensatz zu
manch anderem Film, der meint, sich einer weiteren Dimension bereichern zu
müssen, passt die 3D-Technik hier eindeutig ins Konzept. Cartoon-ähnliche
Actionenszenen, Kamerafahrten und insbesondere das actionreiche Finale sorgen
dafür, dass die Technik hier kein reiner Selbstzweck bleibt.
Was die Geschichte selbst angeht, so unterscheidet sich MEN
IN BLACK 3 nicht grundlegend von seinen Vorgängern: Die Welt wird von schlecht
gelaunten Außerirdischen bedroht, die Spezialagenten müssen die Katastrophe
verhindern – alles nicht besonders spektakulär. Die Auflösung des zu Beginn
aufgeworfenen Geheimnisses aber dürfte so manchem MIB-Fan eine Gänsehaut
zaubern. Es ist auch eben diese Auflösung, die uns mit der etwas schwachen
Storyline auszusöhnen vermag.
Die Macher von MEN IN BLACK 3 haben sich eindeutig Mühe
gegeben, im dritten Teil nicht nur Altbekanntes wiederzukäuen, sondern das
Konzept durch kleinere Innovationen aufzupeppen. Das ist ihnen größtenteils
gelungen, auch wenn eine konsequentere Umsetzung der 60er Jahre Realität dem
Gesamtwerk mehr Pfiff verliehen hätte. MEN IN BLACK 3 ist kein Meisterwerk,
aber solides Blockbuster-Kino, das Fans der Reihe mit liebenswerten Charakteren,
ausgefallenen Aliens und einer angemessenen Prise Selbstironie und Humor zu unterhalten weiß.
KINOSTART: 24. Mai 2012
Pressespiegel auf film-zeit.de
KINOSTART: 24. Mai 2012
Pressespiegel auf film-zeit.de
Dienstag, 8. Mai 2012
Dark Shadows
 |
| © Warner Brothers/ Regie: Tim Burton |
Für ihre achte Zusammenarbeit haben sich Regisseur Tim Burton
und Schauspieler Johnny Depp etwas Besonderes vorgenommen und die 70er Jahre
Kultserie DARK SHADOWS in einen Kinofilm verwandelt. Die Rolle des Vampirs
Barnabas scheint hierbei Johnny Depp auf den Leib geschrieben zu sein.
Nachdem er im 18. Jahrhundert von einer eifersüchtigen Hexe
in einen Vampir verwandelt und lebendig begraben wurde, befreit ihn in den
wilden 70ern endlich jemand aus seinem Gefängnis. Sofort kehrt Barnabas in das
Herrenhaus seiner Familie zurück, in dem jedoch auf Grund finanzieller Engpässe
vom einstigen Glanz kaum mehr etwas übrig geblieben ist. Auch der Collins-Clan ist zusammengesschrumpft. Im Haus leben die Matriarchin Elizabeth (Michelle Pfeiffer),
ihre pubertierende Tochter Carolyn (Chloe Grace Moretz), ihr Bruder Roger
(Jonny Lee Miller) und dessen Sohn David (Gully McGrath). Und dann gibt es noch
die nicht weniger prominent besetzten Angestellten Dr. Julia Hoffman (Helena
Bonham Carter) und Willie (Jackie Earle Haley). Das jüngste Mitglied der
Familie ist Victoria Winters (Bella Heathcote), eine Gouvernante, die
frappierende Ähnlichkeit zu Barnabas’ erster großer Liebe aufweist. Und so ist
es kein Wunder, dass sich der Vampir schnell heimisch fühlt und sich vornimmt,
das einstige Fischereiimperium der Familie wieder aufzubauen. Dabei kommt ihm
jedoch genau die Frau in die Quere, der er seine Vorliebe für Blut zu verdanken
hat: Angelique (Eva Green) ist inzwischen eine erfolgreiche Geschäftsfrau und
nicht weniger teuflisch als noch vor 200 Jahren.
Johnny Depp, der DARK SHADOWS auch produziert hat, konnte
einen wunderbaren Cast für seinen Film gewinnen, der durch Kurzauftritte von
Christopher Lee, Alice Cooper und einigen original Darstellern der 70er Jahre
Serie komplettiert wird. Auch Tim Burton war eigentlich eine gute Wahl, denn die
Arbeit mit der quietschbunten Ausstattung des Films und der grotesken
Atmosphäre ist für den Regisseur im Grunde ein Heimspiel. So gehören die
Kulisse und die Kostüme auch zu den Elementen, die durchgängig begeistern
können, was man leider nicht von allem in DARK SHADOWS behaupten kann.
Das Hauptproblem ist der starke Fokus auf die Figur des
Barnabas. Vielleicht wäre es besser gewesen, sich stärker an der Originalserie
zu orientieren. Hier nämlich tauchte der Vampir erst nach einem Jahr überhaupt
in der Handlung auf. Während die Geschichte mit Victorias Ankunft in der
Familie beginnt und beim Zuschauer den Verdacht weckt, dass die junge Frau
irgendein dunkles Geheimnis hütet, verkommt die Gouvernante mit dem Auftritt
Johnny Depps zur Randfigur. Und das obwohl sich der Vampir umgehend in das
Mädchen verliebt! So wird der Handlungsstrang von Victorias Geschichte radikal
unterbrochen. Aber nicht nur das: Da sie vornehmlich durch Abwesenheit glänzt,
ist auch die Entwicklung der Liebesgeschichte zwischen Barnabas und Victoria
leider nicht besonders überzeugend.
Dass keine Romantik aufkommen mag, liegt auch an der
mangelhaften Konstruktion der Figur des Barnabas. Burton und Drehbuchautor Seth
Grahame-Smith schaffen es nicht, ihn zu einer sympathischen Figur zu machen,
mit der die Zuschauer mitfiebern. Seine Handlungen, insbesondere seine Morde,
sind nicht immer nachvollziehbar und es fehlt ihm der unschuldige Charme eines
Edward mit den Scherenhänden. Im Gegensatz zu dieser Figur ist Barnabas auch
stark sexualisiert: Trotz seiner angeblich tiefen Liebe zu Victoria erliegt er
immer wieder dem Charme anderer Frauen. Selbst die bösartige Angelique kann ihn
durch ihre weiblichen Reize aus dem Konzept bringen. All dies trägt dazu bei,
dass es uns im Grunde wenig interessiert, ob er sein Herzblatt erobern kann
oder nicht.
Die fehlende Sympathie für die Hauptfigur, die so übermäßig
stark im Zentrum dieses Films steht und bedauerlicher Weise die anderen
interessanten Charaktere stark verdrängt, lässt auch die Handlung zunehmend zäh
werden. So richtig mitfiebern können wir nicht. Auch das Ende enttäuscht, in
dem es mit einem „deus ex machina“- Effekt die Rettung in letzter Sekunde auf
höchst unbefriedigende Weise präsentiert. Spätestens hier entwickelt sich der Humor,
der anfänglich durch das Aufeinandertreffen des altertümlichen Vampirs mit der
modernen Welt entsteht, zu unfreiwilliger Komik.
DARK SHADOWS legt einen guten Start hin, indem ein
bekannter und farbenprächtig inszenierter Cast vorgestellt wird (allen voran
Helena Bonham Carter mit der - meiner
Meinung nach – schönsten Frisur ihrer Karriere). Die erste halbe Stunde ist
noch durch regelmäßige Lacher geprägt. Doch der Film schafft es weder, diesen
Humor über den gesamten Film zu transportieren, noch seine Zuschauer durch
Figuren und Handlung bei der Stange zu halten. Dieser sukzessive
Qualitätsverlust des Films erzeugt eine Menge Frust und lässt uns die Andeutung
einer Fortsetzung vor allem als Drohung empfinden. Sehr bedauerlich.
KINOSTART: 10. Mai 2012
Montag, 23. April 2012
UFO IN HER EYES
 |
| © Pandora Films/ Regie: Xiaolu Guo |
Xiaolu Guo zeigt uns ein China, wie wir es selten sehen. Ein
China, das den Einfluss der amerikanischen Kultur nicht nur begrüßt, sondern
herbeisehnt. Ein China, das mit tosendem Applaus den Einzug des Kapitalismus
feiert. Obwohl UFO IN HER EYES durch seine Übertreibungen und ironischen
Spitzen keinen Zweifel daran aufkommen lässt, dass es sich hier nicht um eine
wahrheitsgetreue Abbildung der Realität handelt, ist die kritische Stimme der
Autorin doch deutlich zu vernehmen. In ihren Bestrebungen, in die Zukunft
aufzubrechen, lassen die Menschen ihre Tradition und damit auch ihre Identität
zurück, was zwangsläufig in absurdem Chaos und gar Gewalt endet.
Auch ästhetisch vereint UFO IN HER EYES verschiedene
Elemente. Fantastische Bildwelten und die Übernahme der Perspektive der Tiere –
Schweine, Gänse und Fasane – haben hier ebenso Platz wie das Spiel mit Farbe und
Form. So sehen wir die Welt aus den Augen eines ermittelnden Polizisten in
nüchternem schwarz-weiß, während Kwok Yuns Erinnerung an den geheimnisvollen
Tag der UFO-Sichtung in bunten Farben erstrahlt. Xiaolu Guo inszeniert ihre
Geschichte gekonnt ambivalent zwischen Märchen und Satire und lässt den
Zuschauer bis zum Ende über die Art ihrer Erzählung im Unklaren.
Die absurden Ereignisse, die sich in Folge der Geldspende in
dem kleinen Ort abspielen, sorgen beim Zuschauer nicht nur für in Skepsis erhobene
Augenbrauen, sondern ebenso für amüsiertes Schmunzeln. Manche Details bleiben
jedoch fragwürdig. Allen voran die Tatsache, dass ausgerechnet Udo Kier mit
unüberhörbar deutschem Akzent die amerikanische Kultur verkörpert. Auch wirkt
die Darstellung der Modernisierung des Dorfes stellenweise zu plakativ und wenig
originell. Gerade das Aufkommen von Presserummel und Tourismus erinnert stark
an den ähnlich ausgerichteten Film Live aus Peepli – Irgendwo in Indien.
Vielleicht ist es diesem Mangel Originalität geschuldet, dass die Dramaturgie
die Geschichte nicht ganz zu tragen vermag. Zwar wird der Handlung durch eine
angedeutete Kapitelaufteilung Struktur verliehen, doch entsteht insgesamt zu
wenig Spannung und Emotion, um den Zuschauer anhaltend an die Figuren auf der
Leinwand zu binden.
Xiaolu Guo kritisiert den Kapitalismus ebenso wie den
Kommunismus, blinden Fortschrittsglauben ebenso wie den nostalgischen Blick
zurück, ohne eine realistische Alternative anzubieten. Doch es ist genau diese
Ambivalenz ihres Werks, die es letztendlich möglich macht, über die eigene
Verortung innerhalb dieser verrückten Welt – ob nun in China, Indien oder
Europa – nachzusinnen.
Pressespiegel bei film-zeit.de
Pressespiegel bei film-zeit.de
Montag, 16. April 2012
American Pie - Das Klassentreffen
 |
| © Universal Pictures/ Regie: Jon Hurwitz , Hayden Schlossberg |
Vieles an American Pie – Das Klassentreffen ist wie ein
echtes Wiedersehen mit Schulkameraden: Wir freuen uns selbst über die
unliebsamen Gesichter, erinnern uns an unterhaltsame und unangenehme
Situationen und irgendwie ist das Ganze letztendlich auch ein bisschen
peinlich. Ich habe American Pie – Wie ein heißer Apfelkuchen damals mit großer
Begeisterung im Kino und auf VHS (!) gesehen und mir irgendwann aus
nostalgischen Gründen gar die DVD zugelegt. Somit fühlte ich mich selbst ein
wenig wie auf einem Klassentreffen als ich nun – 9 Jahre nach dem letzten Teil
der Reihe – die bekannten Figuren wiedersehen konnte.
Wie schon in den
ersten drei Teilen steht die Clique von Jim (Jason Biggs), Kevin (Thomas Ian
Nicholas), Oz (Chris Klein), Finch (Eddie Kaye Thomas) und Stifler (Sean
William Scott) im Mittelpunkt. Inzwischen haben sich die ehemals besten Freunde
größtenteils aus den Augen verloren und nutzen das anstehende Klassentreffen,
um in ihrer Heimatstadt endlich einmal wieder gemeinsam die Sau rauszulassen.
Natürlich ist die Zeit an ihnen nicht spurlos vorbei gegangen. Statt des
Verlusts der Jungfräulichkeit stehen nun Ehekrisen, Berufsfindung und das
Unverständnis gegenüber der nachwachsenden Teenager-Generation im Vordergrund. Und
wie immer kommt es insbesondere durch Stifler zu zahlreichen Verwicklungen und
Katastrophen, die das Highschooltreffen vorübergehend gefährden.
Das Beste an American Pie – Das Klassentreffen ist, dass es
dem Team um die Regisseure Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg gelungen ist,
quasi den kompletten Cast aus dem ersten Teil zusammenzuführen. Endlich gibt es
auch ein Wiedersehen mit liebgewonnen Randcharakteren wie dem Sherminator und
den namenlosen Jungs, die einst den Begriff „MIGF“ in den Wortschatz einer
ganzen Generation von Teenagern einführten. Die wahren Stars bleiben aber auch
diesmal Jims Dad (Eugene Levy) und Stiflers Mom
(Jennifer Coolidge), ebenfalls Figuren, die durch den Beginn der Reihe
eine Art Kultstatus erreicht haben.
Trotz der bekannten Gesichter kann der vierte Teil leider
nicht zum Witz des Originals aufschließen. Sicher zeichnete sich auch dieses
nicht durch anspruchsvollen Humor aus, doch scheint es, als wäre die
Schmerzgrenze in den letzten 13 Jahren noch ein wenig gesunken. Zuverlässig
taucht die Unterhaltung unter die Gürtellinie ab und will uns mit nackter Haut,
Körperausscheidungen und sexuellen Anspielungen zum Lachen bringen. Doch das
gelingt in den seltensten Fällen. Vielleicht ist American Pie – Das
Klassentreffen wirklich noch flacher als seine Vorgänger. Vielleicht bin ich
auch einfach nur älter geworden. Wo immer auch die Ursache dafür zu suchen ist,
fest steht, dass mir der aktuelle Film kaum mehr als ein Schmunzeln entlocken
konnte.
Das Konzept American Pie versucht mit der Zeit zu gehen. Durch
Anspielungen auf zeitgenössische Phänomene wie Facebook oder das – inzwischen
auch schon Jahre zurückliegende – Outing von Ricky Martin wird versucht, dem
neuesten Apfelkuchen-Produkt eine gewisse Modernität zu verleihen. So richtig
gelingt das aber nicht, wirken doch die genannten Elemente alle sehr gewollt
und dienen zu offensichtlich nur dazu, ein längst aus der Mode gekommenes
Produkt wieder an den Teenager zu bringen. Und da wären wir gleich beim
nächsten Problem des Films: Wer soll sich das eigentlich ansehen? Die Hauptcharaktere
sind alle in ihren 30ern und reden über die Schwierigkeit, das Sexleben auch
nach der Geburt des ersten Kindes noch spannend zu gestalten. Kann der
pubertäre Jugendliche von heute darüber lachen? Der 30 jährige Zuschauer
hingegen, der die Figuren noch aus seiner Jugend kennt, schlägt sich auf Grund
der platten Witze die Hand vor die Stirn und ist nichts als fassungslos in
Anbetracht der Tatsache, dass er über so etwas einst hat lachen müssen.
Trotz all dieser Kritik habe ich mich in den letzten zehn
Minuten des Films mit American Pie – Das Klassentreffen ausgesöhnt. Denn wie
gesagt, der Film ist wie ein echtes Wiedersehen mit alten Schulfreunden. Auch
wenn es vielleicht peinlich ist, dass mich dieses Konzept vor 13 Jahren noch zu
ausufernder Begeisterung verleitete, so konnte auch ich mich letztendlich - wie
die Figuren auf der Leinwand - ein wenig der Nostalgie hingeben. Nach einem
wenig unterhaltsamen und auch spannungsarmen Mittelteil findet American Pie –
Das Klassentreffen ein rundes Ende, bei dem es uns gar ein wenig warm ums Herz
wird. Dies trifft vermutlich allerdings nur für die Zuschauer zu, die die
American Pie Clique noch aus ihren Anfängen kennt. Und so gilt für diesen Film
dasselbe wie für jedes Klassentreffen: Als Außenstehender hat man hier einfach
nichts verloren!
Mittwoch, 11. April 2012
Chronicle - Wozu bist Du fähig?
 |
| © 20th Century Fox/ Regie: Josh Trank |
Superhelden haben in den letzten Jahren ein echtes Comeback
erlebt. Meist handelt es sich allerdings um durchtrainierte Schönlinge, die
einem Comic-Universum entflogen sind. In Chronicle ist das ein bisschen anders,
denn hier erlangen drei vollkommen normale Teenager überraschend übernatürliche
Kräfte.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht der sozial isolierte
Andrew (Dane DeHaan). Der Vater trinkt, die Mutter ist todkrank, die Mitschüler
mobben ihn und auch sein Cousin Matt (Alex Russel) verhält sich eher
distanziert. Doch Andrews Leben ändert sich, als er beschließt, seinen Alltag
mit einer Kamera aufzunehmen. Neben Aggressionen ruft dieses neue Hobby auch Interesse
bei seinem Umfeld hervor und so kommt es, dass Matt und dessen Kumpel Steve (Michael
B. Jordan) den Nachwuchsfilmer in ein Geheimnis einweihen: Im Wald haben sie
ein mysteriöses Loch gefunden, das sie nun erkunden und für die Nachwelt
festhalten wollen. Das was sie entdecken sprengt ihre Vorstellungskraft.
Plötzlich verfügen die drei Jungs über telekinetische Kräfte, die von Tag zu
Tag stärker zu werden scheinen. Das gemeinsame Erlebnis schweißt sie zusammen
und erstmals glaubt Andrew, so etwas wie echte Freunde zu haben. Doch wie schon
Spidermans Onkel feststellte: Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Kann
der labile Andrew wirklich mit seinen neuen Fähigkeiten umgehen oder wird er
die Kontrolle verlieren und sich und seine Freunde in Gefahr bringen?
Chronicle ist eigentlich gar kein Superheldenfilm, sondern
eine Mischung aus einem Coming of Age Drama und dem Psychogramm eines
potentiellen Highschool-Amokläufers. Im Zentrum stehen nicht die Superkräfte,
sondern Andrews Persönlichkeitsentwicklung. Hierbei bedienen sich Regisseur
Josh Trank und Drehbuchautor Max Landis meiner Ansicht nach zu vieler
Klischees. Die aggressive Vaterfigur, die das Selbstwertgefühl des eigenen
Kindes zerstört, und die schwache Mutter, die beschützt werden muss – plakative
Elemente, die Andrews Sinneswandel erklären und rechtfertigen sollen, unterm
Strich aber wie ein Kapitel aus dem Lehrbuch für pädagogische Psychologie
wirken. So können wir uns emotional trotz der lobenswerten Schauspielleistung von
Hauptdarsteller Dane DeHaan nie ganz auf die Gefühlswelt von Andrew einlassen.
Dramaturgisch legt Chronicle einen guten Start hin, kommt
schnell zur Sache und fesselt unsere Aufmerksamkeit innerhalb kürzester Zeit.
In Erwartung eines actionlastigeren Superheldenfilms jedoch muss irgendwann
eine kurze Phase der Ernüchterung eintreten, in der wir erkennen, dass es hier
eher dramatisch als explosiv zugeht. Immerhin entschädigt dann das fulminante
Ende für die in der Mitte etwas langatmige Handlung. Im Großen und Ganzen macht
Chronicle seine Sache gut und weiß das Publikum zu unterhalten. Da auf
pathetische Dehnungen verzichtet wird, kann der Film mit 84 Minuten eine
wahrlich perfekte Länge vorweisen.
Stilistisch ist da nicht viel Neues. Die Found Footage
Ästhetik ist gerade „in“. Doch Chronicle treibt diesen Trend noch etwas weiter
und legt eine erstaunliche Konsequenz an den Tag, wenn es darum geht,
ausschließlich Bilder zu zeigen, die von verschiedenen
Kameras aufgezeichnet werden. Nicht immer ist das überzeugend, manchmal ist die
Integration der Geräte in den Handlungsablauf sehr erzwungen, doch gerade gen
Ende kann Josh Trank uns mit Hilfe dieses Stilmittels auch ein wenig Ehrfurcht
vor der Omnipräsenz wachsamer Kameralinsen einflößen. Durch Andrews Fähigkeit, die Kamera durch
Telekinese fliegen zulassen, kann die Kameraführung über die gewohnten,
wackligen Found Footage Bilder hinausgehen und wirkt stellenweise gar wie eine
Steadicam.
Chronicle erzählt eine etwas andere Superheldengeschichte,
ist dabei aber leider nicht wirklich originell. Auch Spiderman & Co mussten
sich auf der Leinwand schon mit ihrer dunklen Seite auseinandersetzen. Herausstechen
tut der Film durch seine drei Hauptcharaktere, außergewöhnliche Underdogs, die uns
mit ihrem tapsigen Umgang mit den Superkräften einige Lacher entlocken. Wenn wir
von der missglückten Sozialstudie einmal absehen, lässt sich Chronicle
insgesamt als durchaus gelungenes Unterhaltungskino bezeichnen. Nicht mehr und
nicht weniger.
Montag, 2. April 2012
Nathalie küsst
 |
| © Concorde/ Regie: David & Stéphane Foenkinos |
Sie spielt Nathalie, die als junge Frau mit Francois (Pio
Marmai) einen fast perfekten Mann ehelicht. Märchenhaft wirkt diese Liebe, ein
wenig zu perfekt, um von Bestand zu sein. Und so überrascht es uns als
Zuschauer nicht wirklich, als die Verbindung der beiden durch einen Unfall
ein jähes Ende findet. In tiefer Trauer stürzt sich Nathalie in die Arbeit und
steigt beruflich auf. Doch glücklich ist sie nicht. Vielmehr scheint das wahre
Leben an ihr vorbeizugehen. Das ändert sich erst als sie aus einem unbewussten
Impuls heraus einen ihrer Kollegen küsst. Spontan, ohne Vorankündigung und für
Markus (Francois Damiens) ebenso überraschend wie für uns. Auch ihr berufliches
wie soziales Umfeld kann die wunderschöne Nathalie und den optisch nicht
besonders ansprechenden Markus nur schwerlich zusammenbringen. Nathalie selbst
weiß nicht wie ihr geschieht. Warum hat sie das getan? Fühlt sie sich wirklich
zu Markus hingezogen? Ist sie bereit für eine neue Liebe?
Basierend auf seinem gleichnamigen Roman erzählt David
Foenkinos hier gemeinsam mit seinem Bruder Stéphane die Geschichte einer ganz
besonderen Liebe. Mit dem Set-Design und den Kostümen haben sich die beiden
besonders große Mühe geben. Insbesondere die Büroräume, in denen ein großer
Teil der Handlung spielt, transportieren mit ihren Holztäfelungen und ihrem
etwas antiquierten Flair eine besondere Stimmung: warm und doch unpersönlich.
Hierin spiegelt sich auch die Verfassung der Hauptfigur wider, die auf der
einen Seite als sehr empfindsam, gleichzeitig aber als in sich gekehrt und
distanziert inszeniert wird.
Die Figur des Markus ist der Träger des humoristischen
Anteils des Konzepts. Er wirkt tölpelhaft und unbedarft, aber nicht peinlich oder verschroben. Stattdessen strahlt er von Beginn an eine Herzlichkeit aus, die
die meisten Menschen in seinem Umfeld nicht wahrzunehmen scheinen. Francois
Damiens gelingt es, diese vielschichtige Persönlichkeit glaubhaft darzustellen
und uns mit seiner Mimik und Gestik immer wieder zum Lachen zu bringen. Audrey
Tautou bleibt als Nathalie jedoch schwer zu greifen. Den Großteil des Films ist
sie auf Grund ihres Verlusts so verschlossen, dass es auch dem Zuschauer schwer
fällt, zu ihr eine Verbindung aufzubauen. So dauert es eine Weile, bis wir an
ihrer emotionalen Welt teilhaben können. Dabei ist es besonders interessant,
dass die märchenhafte Liebe zu Beginn des Films weniger zu berühren weiß, als
die zaghafte und verworrene Beziehung, die sich zwischen Nathalie und Markus
entwickelt.
Das Hauptproblem des Films ist die Dramaturgie. Lange Zeit
ist unklar, worauf die Geschichte hinausläuft und was ihr Thema ist. Das liegt
vor allem daran, dass Markus erst sehr spät in die Geschichte eingeführt wird.
Zwar gelingt hierdurch ein großer Überraschungseffekt, der jedoch auf Kosten des
Spannungsbogens geht. Mit der aufkeimenden Büro-Lovestory zieht das Tempo des Films
ein wenig an, verliert gegen Ende jedoch erneut an Zugkraft. Nichtsdestotrotz
finden die Foenkinos-Brüder einen sehr gelungenen Abschluss des Films, der die
verschiedenen Elemente des Films zu einem großen Ganzen zu verbinden weiß.
Ein weiterer Wermutstropfen ist schließlich auch die idealisierende
Inszenierung von Audrey Tautou. Der Film will uns weiß machen, dass die
Verbindung zwischen einer derart atemberaubenden Frau und einem hässlichen
Entlein wie Markus auf ihre Mitmenschen befremdlich und absurd wirken muss. Dabei
ist Tautou hier wie gewohnt weniger eine Diva als eine zarte Kindfrau, die
gehegt, gepflegt und beschützt werden muss. So richtig kann zumindest ich daher
den angeblichen Gegensatz zwischen den Figuren nicht nachvollziehen.
Nathalie küsst ist sicher ein Projekt, in dem viel Herzblut
und übrigens auch ein wirklich schöner Soundtrack steckt. Doch das Endprodukt
kann meiner Meinung nach dem Anspruch seiner Schöpfer nicht gerecht werden und
bleibt eine zwar charmante, letztendlich aber spannungsarme französische Tragikomödie mit einer Audrey Tautou, wie wir sie schon gefühlte hundertmal gesehen
haben.
Montag, 26. März 2012
My Week With Marilyn
 |
| © Ascot Elite/ Regie: Simon Curtis |
Mit dem Oscar hat es nicht geklappt, doch Michelle Williams
zeigt in My Week With Marilyn ohne Frage eine einnehmende Performance. Dabei
steht sie gar nicht im Mittelpunkt der Geschichte, die sich im Grunde um den
jungen Regieassistenten Colin Clark (Eddie Redmayne) dreht, der am Filmset von „Der
Prinz und die Tänzerin“ die Ikone Marilyn Monroe kennenlernt und trotz
Warnungen all seiner Kollegen, ihrem Charme verfällt. Marilyn selbst ist in
diesem Film nicht die überlegene Diva, sondern ein von Unsicherheit und
Einsamkeit geplagtes Mädchen, das in dem jungen Colin vorübergehend einen
tröstenden Begleiter findet.
Michelle Williams gelingt es, ein Kaleidoskop der Gefühle
auf die Leinwand zu bannen. Dabei ist es gar nicht so sehr die Vielzahl an
verschiedenen, manchmal gar widersprüchlichen Emotionen, sondern die Komplexität
der gezeigten Gefühlslagen, die begeistert. In ihrem Gesicht spiegelt sich
nicht nur der Spaß am Rampenlicht, sondern gleichzeitig auch Stress, Angst und
Einsamkeit. Michelle Williams spielt nicht einfach nur Marilyn Monroe. Sie
spielt Norma Jeane Mortenson wie sie Marilyn Monroe spielt. Wäre alles an My
Week With Marylin so überzeugend wie die Leistung von Michelle Williams, wäre
ein filmisches Meisterwerk geboren. Doch so ist es leider nicht.
Obwohl die Figur der Marilyn Monroe insgesamt gelungen in
Szene gesetzt wird – Musik, Close-Ups, Zeitlupen und Standbilder inszenieren
sie gekonnt als Ikone ihrer Zeit – verschenkt die Dramaturgie an zu vielen
Stellen die Chance, diesem Konzept ausreichend Spannung zu verleihen. So ist es
in meinen Augen ein großer Fehler, Marilyn gleich zu Beginn des Films zu
zeigen, statt den Zuschauer mit den Protagonisten ihrem Auftritt
entgegenfiebern zu lassen. Auch der Rest der Story ist spannungsarm und
erinnert in seiner Bandbreite eher an ein Fernsehspiel als an einen Kinofilm.
Colin Clark ist als Hauptfigur gut gewählt. Im Grunde
handelt es sich um eine Coming of Age Story, in der ein junger Mann sich selbst
auf beruflicher und privater Ebene findet. Durch seine Jugendlichkeit und die
damit verbundenen Sehnsüchte und Unsicherheiten, bildet er eine gute Identifikationsfläche
für den Zuschauer. Während Colins Geschichte den Zuschauer überzeugen kann, ist
Marilyn Monroes Biographie mit Melodramatik und Pathos überladen. Auf der einen
Seite wird sie trotz dargestellter Schwachstellen als geradezu gottgleiche
Ikone erschaffen. Gleichzeitig wird es beim Blick in ihre Kindheit schnell
melodramatisch. Wenn Regisseur Simon Curtis sie mit einem Puppenhaus spielen
lässt, um ihre Sehnsucht nach Familie und Heimat zu demonstrieren, schießt er
eindeutig über das Ziel hinaus.
Die Marilyn Monroe, die wir in diesem Film zu sehen
bekommen, überrascht uns durch ihre Verletzlichkeit. Insbesondere auf dem
Filmset wirkt ihre Darstellung irritierend. Ist sie wirklich so unsicher oder
spielt sie das kleine Mädchen, um Aufmerksamkeit und eine Sonderstellung zu
erreichen? Es ist nur Michelle Williams‘ verlässlicher Schauspielleistung zu
verdanken, dass es dem Film in diesen Sequenzen gelingt, Marilyn Monroe trotz
dieses ungewohnten Verhaltens Glaubwürdigkeit zu verleihen. Der Zuschauer wird
somit in dieselbe Position versetzt wie die Filmcrew auf der Leinwand. Sowohl on-screen
Regisseur Sir Laurence Olivier (Kenneth Branagh) als auch das Publikum im
Kinosaal sind zugleich genervt, verzaubert und irritiert durch das exzentrische
Verhalten der Filmdiva.
Aber nicht nur Michelle Williams, auch der restliche Cast
kann überzeugen. Insbesondere Judy Dench begeistert einmal mehr mit ihrem
Charisma. Emma Watson ist zwar im 50er Jahre Kostüm nett anzusehen, doch ihre
Rolle erlaubt es ihr nicht, sich vom Harry Potter Image zu befreien und als
ernstzunehmende Schauspielerin zu etablieren. Eddie Redmaynes überzeugende
Leistung droht neben der starken Präsenz der weiblichen Hauptfigur unterzugehen,
soll aber hier nicht unerwähnt bleiben.
My Week With Marilyn kann insgesamt leider nicht mit seiner
Hauptdarstellerin Schritt halten. So bleibt Michelle Williams in meinen Augen
leider auch der einzige Grund, sich diesen Film anzusehen.
Abonnieren
Posts (Atom)